EN-Normen 1176-1 bis 7
Die europaweit geltenden EN-Normen 1176-1 bis 7 regeln die (sicherheits-)technischen Anforderungen an Spielgeräte bzw. deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung.
In Zusammenhang damit legt eine weitere Norm (EN 1177) Werte für die stoßdämpfenden Eigenschaften des Bodens unter den Spielgeräten fest bzw. beschreibt die Prüfungsmethode hierfür.
Die genannten Normen legen Sicherheitsstandards bei folgenden standortgebundenen Spielgeräten fest:
● auf öffentlichen Spielplätzen,
● in Kindergärten,
● in Schulen und ähnlichen Einrichtungen,
● im Privatbereich (z.B. Gastgärten, Wohnhausanlagen, Spielbereiche in Kaufhäusern).
Unter Spielplatzgeräten werden fix installierte Geräte im Innen- und Außenbereich verstanden. Diese können nach vorgegebenen oder eigenen Spielregeln benutzt werden und sind für ein oder mehrere Benutzer gedacht.
Die Norm legt Anforderungen an Geräte fest, um den Benutzer – bei voraussehbarer bzw. der Bestimmung entsprechender Nutzung des Gerätes – vor Gefahren zu schützen. Das bedeutet aber nicht, dass Aufsichtspersonen von Kindern, die an solchen Geräten spielen, von ihrer Aufsichtspflicht befreit sind.
Die Normen wenden sich in erster Linie an die Gerätehersteller und Spielplatzhalter. Sonderanfertigungen, wie z.B. im Selbstbau hergestellte Geräte sowie Einrichtungen, die in Doppelfunktion auch als Spielgerät dienen (z.B. bespielbare Skulpturen, Klopfstangen, alte Lokomotiven, Feuerwehrautos), sind jedoch ebenfalls davon betroffen.
Eine Ausnahme stellen Geräte und Bauwerke auf Bauspielplätzen bzw. Abenteuerspielplätzen dar, die von den Benutzern selbst gebaut werden. Diese Spielareale sind aus Sicherheitsgründen abgeschlossen und stehen unter ständiger pädagogischer Betreuung und Aufsicht. Man geht davon aus, dass die Betreuungsperson beim Bau „gefährlicher“ Spielgeräte eingreift. Daher müssen diese meist kurzlebigen Geräte auch nicht den Sicherheitsbestimmungen der Norm entsprechen.
Sollte allerdings ein solcherart hergestelltes Gerät später einmal auf einem frei zugänglichen Areal aufgestellt werden, unterliegt es wie jedes öffentlich aufgestellte Gerät den Forderungen der Norm.
Im Handel (Sport-, Spiel- und Freizeitbereich bis hin zu Baumärkten) sind auch „Spielgeräte“ aus Metall für den Privatgarten erhältlich. Diese Geräte werden als „Spielzeug“ gehandelt und unterliegen daher nicht den Spielgerätenormen.
Die Norm EN 1176/ Spielplatzgeräte besteht aus 7 Teilen:
● EN 1176 Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren (gültig seit dem 1. November 1998)
● EN 1176 Teil 2: Zusätzliche besondere Anforderungen und Prüfverfahren für Schaukeln (gültig seit dem 1. November 1998)
● EN 1176 Teil 3: Zusätzliche besondere Anforderungen und Prüfverfahren für Rutschen (gültig seit dem 1. November 1998)
● EN 1176 Teil 4: Zusätzliche besondere Anforderungen und Prüfverfahren für Seilbahnen (gültig seit dem 1. November 1998)
● EN 1176 Teil 5: Zusätzliche besondere Anforderungen und Prüfverfahren für Karussells (gültig seit dem 1. November 1999)
● EN 1176 Teil 6: Zusätzliche besondere Anforderungen und Prüfverfahren für Wippgeräte (gültig seit dem 1. Dezember 1997)
● EN 1176 Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb (gültig seit 1. Dezember 1997)
sowie der Norm hinsichtlich Anforderungen/ Prüfverfahren an Spielplatzböden
● EN 1177: Stoßdämpfende Spielplatzböden, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich auch auf in Selbstbau hergestellte Geräte, zum Bespielen von zur Verfügung gestellten Objekten (z.B. Skulpturen) und ist in analoger Weise auch auf naturnahe Gestaltung anzuwenden.
Die neue Norm gilt im Allgemeinen nicht rückwirkend für bestehende Geräte. Sie bezieht sich auf neu gestaltete Spielplätze seit dem 1. November 1998. Allerdings sind bestehende Spielgeräte, die gefährliche Mängel aufweisen, von der neuen Norm dennoch betroffen.
Als gefährliche Mängel gelten:
● Einzugsstellen beim Einsitzbereich von Rutschen, bei Feuerwehrstangen, bei Dächern, die weniger als 1m von einem Handlauf entfernt sind und
● Fangstellen für den Kopf, insbesondere bei flexiblen Öffnungen (Kletternetz) und Leitern mit Sprossenabständen zwischen 12 und 20 cm.
Diese Mängel sind auch nachträglich zu beheben.
Da die neue Norm sehr ausführlich ist (einige Gerätearten werden zusätzlich in Untergruppen unterteilt), lassen sich nicht immer knappe, allgemein gültige Aussagen für den Gerätetyp (z.B. Schaukel, Karussell, Wippe) treffen. Daher sollte insbesondere beim Selbstbau und bei der Sanierung bestehender Geräte die entsprechende Norm genau studiert bzw. der TÜV oder Fachfirmen konsultiert werden.
Die wichtigsten Neuerungen
● Es wird zwischen Spielgeräten, die für Kinder ab 3 Jahren, und Spielgeräten, die auch für Kinder unter 3 Jahren geeignet sind, unterschieden. Das bedeutet insbesondere Veränderungen bei der Ausführung von bekletterbaren Spielgeräten.
● Sicherheitsabstände zwischen den Geräten werden in Abhängigkeit zur Fallhöhe gebracht.
● Es gibt keine verbindlichen Zusammenhänge bzw. Angaben über Fallhöhe und den zugehörigen falldämpfenden Böden. Es wird eine Eignungsüberprüfung jedes falldämpfenden Bodens empfohlen.
● Es gibt kaum fixe Angaben zu Öffnungsweiten. Stattdessen werden zur Überprüfung genau beschriebene Prüfkörper verwendet.
● Hersteller sind zur genauen Kennzeichnung der Spielgeräte sowie zu Angaben über Pflege, Wartung und empfohlenem Fallschutz verpflichtet.
● Dem Spielplatzhalter ist die Durchführung von Inspektion, Pflege und Wartung (mit schriftlichen Aufzeichnungen) dringend anzuraten.
Sicherheitsanforderungen an Spielplätze und Spielflächen/ Sicherheitsabstände
Die EN 1176 – 1. Teil geht davon aus, dass die Höhe des Gerätes und der Sicherheitsabstand in Zusammenhang stehen. (Sie definiert einen Fallraum, d.h. den Raum, den man bei einem Sturz einnehmen könnte. Je höher das Gerät, desto größer kann die Fläche sein, auf die man aufprallt.) Daher werden die Sicherheitsabstände in Abhängigkeit zur Fallhöhe gesetzt. Als Faustregel sollte man bei Geräten bis 1,5 m Fallhöhe mindestens 1,5 m Abstand zwischen statischen Geräten, bis 3 m Fallhöhe mindestens 2,5m annehmen. Bei Geräten mit beweglichen Teilen – wie Schaukel oder Karussell – sollte man sich an die Herstellerangaben bzw. an die Angaben der betreffenden Gerätenorm halten.
Sicherheitsanforderungen an Spielgeräte
Bei geschlossenen Geräten – die über 2 m Raumtiefe aufweisen (z.B. Spielhaus, Kletterturm, Baumhaus) – müssen mindestens 2 Eingänge vorhanden sein. Die Norm geht davon aus, dass im Brandfall evtl. ein Eingang unpassierbar sein könnte.
Die ursprüngliche Regelung der waagrechten und senkrechten Öffnungen wurde durch eine generelle Neudefinition ersetzt: Die Geräte müssen so konstruiert sein, dass es zu keinen gefährlichen Fangstellen für Kopf, Körper, einzelne Gliedmaßen oder Kleidung kommt.
Das bedeutet, dass der Benutzer weder mit dem Kopf voran noch mit den Füßen voran im Gerät stecken bleiben darf. Das Spielgerät darf keine teilweise umschlossenen oder
V-förmigen Öffnungen, keine Scherstellen oder beweglichen Öffnungen aufweisen. Kleidung darf sich nicht in Spalten, V-förmigen Öffnungen, Spindeln/ drehenden Teilen oder Vorsprüngen verhängen können.
Seitens der Norm werden spezielle Prüfkörper zur Untersuchung vorgeschlagen. Diese sind in der EN 1176 – 1.Teil beschrieben. Beim Selbstbau von Geräten empfiehlt es sich daher Fachfirmen bzw. den TÜV zu kontaktieren, um die Erfordernisse im Einzelfall zu klären.
Klettertaue müssen an beiden Enden verankert sein.
Fallhöhe und Fallschutz
Die bisher verbindliche Tabelle über Fallhöhen und entsprechenden Fallschutz wird durch eine Tabelle, die lediglich der Orientierung dient, ersetzt. Die neue Norm geht davon aus, daß Böden im Hinblick auf Qualität große Differenzen aufweisen können und daher keine allgemein gültige Aussage getroffen werden kann. So kann ein gut gepflegter Rasen mit entsprechendem Erdboden für eine große Fallhöhe geeignet sein, ein schlecht gepflegter Rasen – der nur noch verdichtete Erde ist (steinhart im trockenen Zustand) – minimale falldämpfende Eigenschaften aufweisen.
Daher wird für „ungeprüften“ Rasen max. 1 m Fallhöhe erlaubt. Die neue europäische Norm fordert eine regelmäßige Prüfung der Böden und empfiehlt, bei Fallschutzplatten unbedingt ein Zertifikat (mit einer Angabe, für welche Fallhöhe der Belag geeignet ist) zu verlangen.
Bei losem Fallschutzmaterial (Sand, Kies, Rindenmulch und -häcksel) werden zur bisher geforderten Schichtdicke von 30 cm zusätzlich 20 cm gefordert, weil dieses Material „weggespielt“ wird („Löcher“ unter den Schaukelsitzen).
Fallhöhe und Absturzsicherung
Absturzsicherungen sind überall dort vorzusehen, wo es durch Drängen und Stoßen zu einem Sturz kommen kann.
Da die Norm davon ausgeht, dass auch Kinder unter 3 Jahren Spielgeräte benutzen könnten, müssen Geräte bereits ab einer Fallhöhe von 60 cm mit Brüstung oder Geländer ausgestattet sein oder für Kleinkinder unter 3 Jahren unzugänglich gemacht werden.
Es gibt – je nach Benutzergruppe – zwei Varianten der Geländerausführung:
● Bei Geräten, die für Kinder jeden Alters – also auch unter 3 Jahren – zugänglich sind, bedarf es ab einer Spielebene (Plattform) von 60cm Höhe einer Brüstung oder einer geschlossenen Begrenzung (Platten). Auch ein absolut „geschlossenes“ Gerät ist möglich. Dieses darf von außen nicht bekletterbar sein.
● Geräte, die nur für Kinder über drei Jahre gedacht sind, brauchen einen „erschwerten Zugang“. Plattformen mit 60 cm brauchen kein Geländer, Plattformen höher als 1 m Geländer und erst ab 2 m Fallhöhe eine Brüstung. Bei der Sanierung von „Altgeräten“ sind diese neuen Bestimmungen zu beachten.
Sicherheitsanforderungen an Spielgerätetypen
Klettergeräte und Spielturm
Die neuen Normen treffen eine Unterscheidung zwischen Geräten, die nur für Kinder, die älter als 3 Jahre sind, gedacht sind, und Geräte, die für alle Altersstufen, also auch für Kinder unter 3 Jahren, bespielbar sein sollen. Dieser Punkt ist sehr wichtig, weil er bedeutet, dass besonders bei Klettergeräten entweder auf einen erschwerten Zugang zu achten ist oder bereits ab 60 cm Höhe ein Geländer bzw. eine Brüstung vorgesehen werden muss.
Als erschwerter Zugang gelten Zugänge über schräge Rampen, über Balancierbalken, mittels eines Klettertaues oder einer Hangelstrecke.
Da die genannten Zugänge nur Beispiele für viele Möglichkeiten darstellen, empfiehlt es sich, die gewünschte Zugangsvariante mit dem TÜV abzuklären, insbesondere bei Selbstbau von Geräten bzw. bei der Gerätesanierung.
Die offenen Teile zwischen den Leitersprossen müssen entweder kleiner als 11 cm (bei Geräten für Kinder unter 3 Jahren kleiner als 8,9 cm) oder größer als 23 cm sein.
In der Praxis wird man daher die Öffnung generell größer als 23 cm machen bzw. die Situation mit dem TÜV oder einem Sachverständigen klären.
Rutsche
Bei kombinierten Rutschen (z.B. als Teil eines Kletterturmes) muss ab einer Fallhöhe von 1 m eine Absturzsicherung vorgesehen werden. Diese sollte 70-90 cm hoch und vor dem waagrechten Einsitzteil positioniert sein.
Die Länge des waagrechten Rutschenendes und die Höhe der Seitenwangen sind abhängig von der Rutschenhöhe:
Die Seitenwangen müssen entlang der Rutschstrecke fortlaufen: bis 1,5 m Rutschenhöhe mindestens 10 cm hoch, bis 2,5 m Rutschenhöhe mindestens 15 cm und über 2,5 m Rutschenhöhe mindestens 50 cm hoch.
Das waagrechte Rutschenende muss bei 1,2 m Rutschenhöhe mindestens 30 cm lang sein, bei höheren Rutschen zwischen 50 und 150 cm.
Der Abstand vom waagrechten Auslaufteil zum darunter liegenden Boden sollte max. 35 cm betragen.
Frei stehende Rutschen sollten einen Handlauf in mindestens 70 cm Höhe aufweisen.
Wippe
In der EN 1176 – 6. Teil werden 3 Wippgerätetypen mit unterschiedlichen Forderungen hinsichtlich Fallraum und Ausführung festgelegt.
Für alle Typen gilt aber folgendes:
● Um das Einquetschen zwischen Wippenende und Boden zu verhindern, müssen Wippen entweder eine Dämpfung, Fußstützen oder durch sonstige Maßnahmen mindestens 23cm Bodenfreiheit aufweisen.
● Handgriffe (Griffdurchmesser 16,3 mm) müssen so ausgeführt sein, dass sie keine Fangstellen für den Kopf bieten.
● Um Quetschungen im Auflagerbereich zu vermeiden, sollten Wippbalken nur eine geringe Querbewegung am Wippenende aufweisen.
Schaukeln
Der seitliche Abstand vom Schaukelsitz zum Schaukelgerüst und der Abstand zwischen den Schaukelsitzen ist in EN 1176 – 2. Teil neu geregelt. Er ist abhängig von der Schaukelhöhe (= Länge der Kettenaufhängung):
Der Wert entspricht bei den meisten Schaukeln in etwa dem bisher gültigen 70 cm Abstand, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Aufhängung nach oben hin schräg auseinanderläuft, um die Stabilität des Schaukelsitzes zu erhöhen.
Weiters werden die maximale freie Fallhöhe (als maximale freie Fallhöhe gilt die halbe Länge der Aufhängung + Sitzhöhe) und die Fläche des stoßdämpfenden Bodens angegeben. Bei 60° Auslenkung werden bei Fallschutzplatten (synthetischen Böden) zusätzlich 175 cm, bei losem Fallschutzmaterial zusätzlich 225 cm gefordert.
Schaukeln und Schwingseile dürfen nicht im selben Gerät kombiniert werden.
Die neue Norm empfiehlt ausdrücklich, Schaukeln in umrandeten Bereichen aufzustellen, um Unfälle durch das Hineinlaufen in den Schaukelbereich zu vermeiden. Die Zugänge zum Schaukelbereich sollten möglichst so ausgeführt sein, dass sich das Kind nur langsam nähern kann.
Bei Kombigeräten muss, wenn die Schaukelstütze z.B. Kletterfunktion aufweist, der seitliche Abstand vom Sitz zum Schaukelgerüst 1,5 m betragen.
Karussell
In der EN 1176 – 5. Teil werden 5 verschiedene Karusselltypen unterschieden. Das bedeutet, dass je nach Typ unterschiedliche Anforderungen gestellt werden und insbesondere dieser Teil umfangreich ist. Daher ist es empfehlenswert, sich sowohl für die Überprüfung als auch für die Sanierung über die spezifischen Erfordernisse zu informieren.
Naturnahe Elemente
Die Länge eines Kriechtunnels ist abhängig von seinem Durchmesser und seiner Ausführung:
Die Länge eines einseitig offenen Kriechtunnels (z.B. im Spielhügel integriert) darf max. 2 m betragen, der Durchmesser muss mindestens 75 cm aufweisen.
Bei Weidenhäuschen sollten die Sicherheitsauflagen analog angewendet werden, d.h. z.B. dass bei einer bekletterbaren Ausführung die Fallhöhe oder Fangstellen, die mehr als 60 cm über dem Boden liegen, ebenso wie bei herkömmlichen Spielgeräten zu beachten sind.
Instandhaltung und Wartung von Spielgeräten und Spielplätzen
Die Bestimmungen hinsichtlich Wartung gelten wie früher, sind allerdings exakter formuliert. Es wird dringend empfohlen, Aufzeichnungen in schriftlicher Form (z.B. mit Hilfe einer Checkliste) über die regelmäßige Prüfung (z.B. durch einen Bediensteten der Gemeinde) zu führen. Sie können im Zweifelsfall als Nachweis für die regelmäßige Wartung dienen. Genaue Angaben bezüglich der Pflichten des Spielplatzbetreibers/-halter enthält die EN 1176/7.
Die EN 1177 empfiehlt zusätzlich eine regelmäßige Bodenüberprüfung, da sich die Eigenschaften von Naturböden im Laufe der Zeit ändern können. Da bei losem Fallschutzmaterial die Pflege ein wichtiges Qualitätskriterium ist, sollte dieses regelmäßig gerecht, von Verschmutzungen befreit und unter das Spielgerät zurückgeschaufelt werden. Um die Pflege zu erleichtern, empfiehlt es sich, direkt am Gerät (z.B. bei der Schaukel auf dem Steher) eine Markierung für die geforderte Schichthöhe (Füllhöhe) anzubringen.
Die Stoßdämpfung von Naturböden kann im Zuge der jährlichen Inspektion durch eine Fachfirma, z.B. den TÜV, geprüft werden.
Hersteller müssen bei der Lieferung eines Spielgerätes sämtliche Angaben in Bezug auf Benützung, Wartung und Pflege des Gerätes bzw. Angaben zum Fallschutz geben.
Es ist daher empfehlenswert, dass der Gerätelieferant auch den Fallschutz liefert bzw. einbaut.
Hinweise für die Planung
Bei der Gestaltung/Möblierung von Spielplätzen mit Naturelementen wie Wurfsteine, Baumstämme, Kletterwände aus Naturstein, etc. sind die Bestimmungen der Normen „sinngemäß“ anzuwenden.
Sicherheit am Spielplatz ist nicht nur eine Frage der Sicherheit einzelner Geräte und deren Fallschutz/Sicherheitsabstände, sondern auch eine Frage der Gesamtgestaltung des Platzes (und dessen Zugänge).
Bei Gestaltung, Auswahl und Kombination von Spielgeräten sollte daher zwischen Sicherheit und Attraktivität abgewogen werden.
Die Unfallgefahr kann steigen, wenn Spielgeräte langweilig sind und zu unsachgemäßem Gebrauch anregen.
Der Versuch absolute Sicherheit zu erreichen, würde auch bedeuten, dem Menschen eine heile Welt vorzugaukeln und den Erfahrungsbereich „Gefahr“ aus der Erziehung des Kindes auszuklammern. Es geht nicht darum die Risiken abzuschaffen, sondern darum, das Kind mit ihnen vertraut zu machen.
Es ist daher Aufgabe der Spielplatzplanung, den Kindern Möglichkeiten zu schaffen „den Umgang mit sich selbst“ zu üben – ein persönliches Gefahrenbewusstsein zu entwickeln. Wenn Kinder in der Lage sind ihre Fähigkeiten richtig einzuschätzen und für sie bedrohliche Gefahren zu erkennen, würden sich die Spielplatzunfälle, welche durch unvorsichtiges, übermütiges und unsicheres Verhalten entstehen, verringern. Diese Unfälle machen ca. ein Fünftel aller Spielplatzunfälle aus.
Die Spielplatzplanung ist als „gelungen“ zu bezeichnen, wenn sie dem Benutzer die Möglichkeit bietet:
● Gefahren zu erkennen
● seine eigenen Fähigkeiten abschätzen zu lernen
● den Umgang mit Mut und Angst zu üben
● Hilfestellung durch andere zu erleben
● die eigenen Fähigkeiten – also sich selbst – und die Umwelt (Hilfestellung = Sozialkontakt, aber auch Begegnung mit dinglicher Umwelt) besser kennen zu lernen.
Eine „gelungene“ Spielplatzplanung berücksichtigt auch den Aufwand für die lt. EN geforderte „Inspektion, Wartung und Betrieb“, also die ständig wiederkehrenden Pflichten des Spielplatzbetreibers bzw. Spielplatzhalters. Denn dies mindert den Aufwand Ihrer Gemeinde.
Nebenbei eine wichtige Information: „Durch das Anwenden von Normen entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.“ So lautet eine Antwort des DIN Institutes anlässlich einer Anfrage bezüglich Regressforderungen an das DIN (vgl. hierzu DIN 820-1 Abschnitt 6.6).
Das schon mehrfach genannte Normenwerk EN 1176-1 bis 7 bezieht sich auf Spielgeräte. Es schließt – wie schon erwähnt – Abenteuerspielplätze aus; gilt also nicht für betreute Spielbereiche. Es gilt jedoch auch für Geräte und Einrichtungen, die als „Spielgeräte“ aufgestellt werden, obwohl sie nicht als solche hergestellt sind (z.B.: Kunstwerk, Lokomotive, etc.).
Analog gilt dies also auch für natürliche und gestaltete Landschaftselemente wie z.B. Steinschichtungen, Trockenmauern, für naturnahe Bereiche sowie Bereiche zur Förderung des Naturerlebens und der Sinneswahrnehmung.
Für die Planung letztgenannter Bereiche sind insbesondere die Bestimmungen der EN 1176-1 und 1177 wichtig. Bei Fragestellungen, die diese Normen nicht erfassen – wie z.B. Wasserflächen – sind:
● die B 2607,
● die DIN 18034 und in weiterer Folge die bereits genannten Kriterien
● überschaubare Gefahr
● von vornherein erkennbare Gefahr
● Herausführen der Benutzer an ein gesundes Gefahrenbewusstsein
für die Planung heranzuziehen. Das bedeutet, dass z.B. eine Ufergestaltung so erfolgen muss, dass bespielbare Bereiche von nicht bespielbaren Teilen eindeutig zu unterscheiden sind. Das natürliche Angstempfinden der Kinder zu wecken ist das Gestaltungsziel.
Spielplatzplanungen sind – gegebenenfalls als Modell – von Sachverständigen oder dem TÜV zu prüfen. Es empfiehlt sich, die realisierte Einrichtung vor Inbetriebnahme des Platzes nochmals prüfen zu lassen. Im Zuge dieser Prüfungen sind auch die notwendigen Inspektions- und Wartungsanweisungen für den Betreiber/Halter festzuschreiben. Dies ist letztlich auch Ihre Aufgabe als Planverfasser.
Wenn für einen Spielplatz eine neue „Spielidee“ – also ein neues Spielgerät – entwickelt wird, müssen die entsprechenden Forderungen aus der Normenserie abgeleiten werden.
In Bezug auf eine Sicherheitsprüfung bzw. die Erstellung einer Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb gilt das vorher gesagte gleichermaßen.
Bei neuen Spielideen, naturnahen (unbetreuten) Bereichen, aber auch bei Spielpunkten in Parks und Fußgeherbereichen ist bei den Überlegungen zum Thema Sicherheit auch der Jahreszeitenwechsel und damit die Veränderung der Materialien bzw. deren Eigenschaften im „Spielbetrieb“ mit zu bedenken.
Zur Lage des Spielplatzes
Schon bei der Standortgestaltung sind Aspekte der Sicherheit zu bedenken.
Die Lage des Platzes bzw. die Gestaltung seines Umfeldes bzw. die Ausbildung der Erreichbarkeit sind ein wesentlicher Bestandteil der „Sicherheit des Platzes“.
Außerdem beeinflussen Standort und Zugänglichkeit des Spielplatzes wesentlich dessen Benutzungshäufigkeit und Benutzungsdauer.
Der Standort und die Benutzungshäufigkeit beeinflussen auch die Sicherheit von Mädchen auf dem Spielplatz. Lage und Gestaltung des Platzes sollen dafür sorgen, dass immer wieder Passanten den Platz queren oder daran vorbeikommen. So entsteht eine Form von Sozialkontrolle, die eine gewisse Sicherheit vor Belästigung garantiert.
Bei der Einfriedung der Spielplätze, bei der Gestaltung der Zugänge und bei der zusätzlichen Ausstattung (z.B. Trinkbrunnen, Waschgelegenheit etc.) sind die Bestimmungen der Norm zu beachten.
Wenn ein Spielplatz nur wenige Spielmöglichkeiten und nur kurzfristig interessante Spielmöglichkeiten bietet, kommt es meist dazu, dass Kinder Einrichtungen und Geräte missbräuchlich und unsachgemäß benutzen.
Die Autoren der Studie „Wie sicher sind Spielplätze in Wien?“ (Institut „Sicher Leben“, Wien 1997) stellen die Frage „Ob ein sicherer Spielplatz nicht geradezu eine unsachgemäße Verwendung der Spielgeräte herausfordert.“
Sie schreiben in der Studie, „dass kindliche Kreativität mit professioneller Ästhetik und akribischem Sicherheitsstreben kollidiert“. Zum Beispiel konnte beobachtet werden, dass auf einer Baustelle ungefähr 5 mal so viele Kinder spielten, als am daneben liegendem Kinderspielplatz. Es ist daher naheliegend, dass ein Spielplatz der zwar „sicher“ im Sinne der Normen ist, der aber wenig Anreiz für Spiel bietet, die Kinder zu unsachgemäßen Verhaltensweisen verleitet.
Gültigkeit der Normen
Die eingangs genannten EN-Normen gelten seit 1. Dezember 1997 (EN 1177) bzw. seit 1. November 1998.
Die Normen sind Regel der Technik, jedoch gesetzlich nicht verbindlich.
Auch für Fallhöhen > 60cm (z.B. bei Wipptieren) ist ein Boden mit stoßdämpfender Eigenschaft erforderlich.
Es gibt keine verbindliche Aussage zur Ausführung eines erschwerten Zuganges zu Geräten für Kinder unter drei Jahren.
Adolf Wocelka (Architekt Dipl.-Ing.) in der ÖGZ (Österreichische Gemeindezeitung) 12/99 – Österreichischer Städtebund



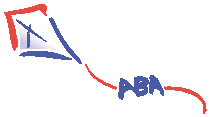 Die Hagener Erklärung wurde einstimmig von den Teilnehmer(inne)n des ABA-Kongresses „Risiko als Spielwert“ am 29. November 1995 in Hagen verabschiedet. Der Kongress wurde von 80 Teilnehmer(inne)n besucht.
Die Hagener Erklärung wurde einstimmig von den Teilnehmer(inne)n des ABA-Kongresses „Risiko als Spielwert“ am 29. November 1995 in Hagen verabschiedet. Der Kongress wurde von 80 Teilnehmer(inne)n besucht.




















 (Foto: spielplatztreff.de)
(Foto: spielplatztreff.de)

