Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen
SoVD: Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen
Landesverband NRW
Landespolitische Handlungsbedarfe zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention – BRK) normiert erstmals in völkerrechtlich bindender Weise die Menschenrechte der Menschen mit Behinderung. Damit wird kein Sonderrecht für behinderte Menschen geschaffen, sondern die allgemeinen Menschenrechte werden aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung klargestellt und konkretisiert.
Mit Inkrafttreten der BRK am 26.03.2009 als Teil des deutschen Rechts ist die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, eine umfassende Gleichstellung und Teilhabe behinderter Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft sicherzustellen. Die Bestimmungen der Konvention binden Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen und uneingeschränkt. (1) Alle staatlichen Ebenen sind zu ihrer Umsetzung mittels sämtlicher geeigneter Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen verpflichtet. (2) Bei der Erarbeitung und Umsetzung entsprechender politischer Konzepte und Rechtsvorschriften haben sie die Organisationen behinderter Menschen „eng“ zu konsultieren und sie aktiv einzubeziehen.(3) Der SoVD NRW begrüßt das vorliegende Anhörungsverfahren der Landesregierung als Einstieg in diesen Prozess.
Die Umsetzung der BRK erfordert die systematische Überprüfung aller rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten, die das Leben von Menschen mit Behinderung betreffen, auf etwaige Anpassungsbedarfe zur Erfüllung der Anforderungen der Konvention. Dieser Prozess betrifft alle Ressorts der Landesregierung und wird fachliche Fragen auf vielfältigen Gebieten aufwerfen. Das Verfahren zur Umsetzung der BRK sollte so gestaltet werden, dass einerseits die als erforderlich und geeignet anerkannten Maßnahmen unverzüglich umgesetzt werden. Andererseits sollte es jederzeit für Ergänzungen oder Modifikationen offen bleiben („lernendes“ Verfahren).
Der SoVD NRW hebt hervor, dass die Definition von Behinderung in Art. 1 Satz 2 BRK auch pflegebedürftige alte Menschen einschließt. Dies ist in Deutschland bereits durch die Legaldefinitionen von Behinderung (§ 2 SGB IX) und Pflegebedürftigkeit (§ 14 SGB XI) sozialrechtlich geregelt, wird aber in der Praxis bislang nur selten beachtet.
Der SoVD NRW regt an, zur Umsetzung der BRK in Nordrhein-Westfalen ein jederzeit fortschreibungsfähiges Aktionsprogramm des Landes zu entwickeln, in das alle geeigneten Maßnahmen aufgenommen und jeweils mit einer voraussichtlichen zeitlichen Realisierungsperspektive sowie finanzplanerisch mit ggf. erforderlichen Haushaltsmitteln unterlegt werden. Die Landesregierung sollte dem Landtag, den Organisationen behinderter Menschen und weiteren beteiligten Akteuren einen jährlichen Bericht über den Stand der Umsetzung des Aktionsprogramms vorzulegen.
Zur Durchführung und Überwachung des Umsetzungsprozesses in Gebieten, die der Regelungskompetenz des Landes unterliegen, sind die Bestimmungen des Art. 33 BRK auf Landesebene anzuwenden. Danach bestimmen die Vertragsstaaten zur Durchführung der BRK eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen „nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation“ sowie eine „Struktur“ zur Überwachung des Umsetzungsprozesses „nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems“. In Deutschland dürfte hier dem föderalen Aufbau des deutschen Bundesstaats mit der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern Rechnung zu tragen sein. Die organisierten Interessenvertretungen behinderter Menschen werden gem. Art. 33 in den Überwachungsprozess einbezogen und nehmen in vollem Umfang daran teil.
Im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland wirken die Länder an der Gesetzgebung des Bundes mit. Insbesondere die materiellen und sozialen Lebensbedingungen behinderter Menschen in Nordrhein-Westfalen werden meist stärker von Entscheidungen der Bundespolitik beeinflusst als von der Landespolitik. Daher können und sollten auch bundesrechtliche Handlungsbedarfe, insbesondere im Bereich des Sozialrechts, in die Diskussion auf Landesebene einbezogen werden. Da aber die Diskussion über die bundespolitischen Handlungsbedarfe zur Umsetzung der Konvention vorrangig von und mit den Bundesverbänden behinderter Menschen zu führen sein wird, beschränken wir uns vorliegend weitgehend auf Fragen in originärer Regelungs- bzw. Handlungskompetenz des Landes.
Der SoVD NRW sieht landespolitische Handlungsbedarfe zur Umsetzung der BRK gegenwärtig (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) insbesondere in folgenden Fragen:
1. vom selektiven zum inklusiven Bildungswesen: eine Schule für alle
2. Barrierefreiheit („Zugänglichkeit“) in den Bereichen Bauen und Verkehr
3. selbstbestimmtes, barrierefreies Wohnen
4. Barrierefreie öffentlich zugängliche Dienste und Einrichtungen
(insbesondere: Beratungsinfrastrukturen, Arztpraxen, Frauenhäuser)
5. Anpassung des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW
6. Öffentlich-rechtliche Medien
7. „Disability Mainstreaming“
Darüber hinaus hält es der SoVD NRW für geboten, die notwendige Mitwirkung der Interessenvertretungen behinderter Menschen an Vorbereitung, Durchführung und Überwachung des Umsetzungsprozesses so zu gestalten, dass eine Kluft zwischen den Partizipationsansprüchen der BRK und der Praxis vermieden wird.
1. Vom selektiven zum inklusiven Bildungswesen: eine Schule für alle
Der wohl weitreichendste landespolitische Handlungsbedarf besteht im Bildungswesen, insbesondere im Schulsystem. Art. 24 BRK fordert von den Vertragsstaaten in der englischen, rechtlich verbindlichen (4) Wortlautfassung, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten („States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels“). Dazu müssen die Vertragsstaaten sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom „allgemeinen“ Bildungssystem ausgeschlossen werden und sie gleichberechtigt mit anderen Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht haben. Die notwendige Unterstützung zur Erleichterung des Bildungserfolgs ist „innerhalb des allgemeinen Bildungssystems“ zu leisten. Darüber hinaus sind für Bedürfnisse im Einzelfall „angemessene Vorkehrungen“ (5) zu treffen.
Zwischen dem Begriff der Inklusion und dem aus politischen Motiven zur deutschen Übersetzung von „inclusion“ benutzten Begriff der Integration besteht ein großer Unterschied. (6) Integration (Eingliederung) verlangt eine Anpassungsleistung des betroffenen Menschen an ein gegebenes System und legitimiert im Fall des Misslingens seine Exklusion (Ausschluss). Ein „integratives“ System bleibt daher stets selektiv. Dagegen verlangt Inklusion (Einschluss) umgekehrt die Anpassung des Systems an die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen in ihrer Vielfalt und Verschiedenheit. Nicht das Kind soll sich der Schule anpassen, sondern die Schule dem Kind. Eine Schule ist erst dann inklusiv, wenn sie die Individualität jedes Kindes – mit und ohne Behinderung, mit und ohne Migrationshintergrund, aus armen wie aus reichen Familien – respektiert und sie als Vielfalt und Bereicherung anerkennt, anstatt das „Anderssein“ zum Grund des Ausgrenzens und Aussonderns zu machen. Der Inklusionsgedanke prägt die Philosophie der BRK nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch insgesamt.
Die Diskussion um die Wichtigkeit und Richtigkeit des gemeinsamen Lernens behinderter und nicht behinderter Kinder ist in der Wissenschaft bereits seit Jahrzehnten entschieden. Schon 1973 empfahl der Deutsche Bildungsrat für die pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher „ein flexibles System von Fördermaßnahmen, das einer Aussonderungstendenz der allgemeinen Schule begegnet, gemeinsame soziale Lernprozesse Behinderter und Nichtbehinderter ermöglicht und den individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen behinderter Kinder und Jugendlicher entgegenkommt“. Zugleich betonte er: „Die dadurch zustande kommende gemeinsame Unterrichtung von behinderten und nicht behinderten Kindern bringt eine sonderpädagogische Verantwortung für die allgemeine Schule mit sich, die sie bisher nicht wahrzunehmen brauchte, weil es neben ihr die Sonderschule gab und noch gibt.“ (7)
Seither haben zahlreiche Schulversuche und wissenschaftliche Studien die Vorteile der gemeinsamen Beschulung gegenüber der Sonderbeschulung behinderter Kinder in überaus deutlicher Weise dokumentiert. Dies gilt grundsätzlich unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung. Andere europäische Staaten leben seit langem vor, dass inklusive (zugleich qualitativ hochwertigere) Bildungssysteme möglich sind und erreichen Inklusionsquoten von 80 % und mehr. Dennoch hielt man hierzulande am herkömmlichen, selektiven Schulsystem fest und beschränkte sich auf meist nur bescheidene integrative Öffnungen innerhalb desselben.
Mit der Überführung der UN-BRK in deutsches Recht ist das „Ob“ einer inklusiven Bildungsreform nunmehr entschieden. Jetzt geht es um das „Wie“. Aus Sicht des SoVD NRW geht es darum, das Regelschulsystem systematisch zu befähigen, seinen Bildungsauftrag bis zum Ende der Pflichtschulzeit (Klasse 10) auch für behinderte Kinder zu erfüllen. Nach Auffassung namhafter Sachverständiger ist es möglich, innerhalb von 10 Jahren eine Inklusionsquote von 80 % zu erreichen. (8) Die Landesregierung sollte sich dem Ziel verpflichten, diese Quote innerhalb eines entsprechend definierten Zeitraums für NRW zu erreichen. Darüber hinaus wird die Erschließung und Ausschöpfung der Inklusionspotenziale des Regelsystems zeigen, ob, wofür und wie viele besondere Schulen für behinderte Menschen am Ende noch erforderlich sind.
Ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen ist allerdings nicht erreichbar, ohne das Regelsystem selbst grundlegend zu verändern. Ein Schulsystem, das auf systematischer Selektion der SchülerInnen gründet, und das deshalb ein Sondersystem von Förderschulen benötigt, um diejenigen aufzufangen, die durchs Rost fallen, ist strukturell nicht inklusionsfähig. Zwar können im bestehenden System zweifellos höhere Integrationsquoten erreicht werden als bisher. Doch die von anderen europäischen Ländern gesetzten Maßstäbe bleiben innerhalb dieses Systems unerreichbar.
Ein inklusives Schulsystem, dass jedes Kind in der Besonderheit seiner Individualität, mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen, Fähigkeiten und Beeinträchtigungen annimmt, um ihm die bestmögliche Förderung und Bildung zu ermöglichen, basiert auf dem Prinzip der Heterogenität, der Anerkennung der Verschiedenheit und Vielfalt der Kinder. Inklusive Schule richtet ihre Arbeit mit Binnen- und Zieldifferenzierung an den individuellen Potenzialen, am individuellen Lern- und Entwicklungstempo aus, um bis zum Ende der Pflichtschulzeit individuell unterschiedliche Bildungsziele zu erreichen. Zieldifferenz ist normal.
Das herkömmliche dreigliedrige Regelschulsystem basiert dagegen auf der Fiktion einer im Voraus (!) festlegbaren Leistungshomogenität und einer vorgegebenen Zielgleichheit, sowohl für die jeweilige Schulform und deren Bildungsabschluss wie auch für den jeweiligen Klassenverband („Klassenziel“: Versetzung). Würde man nun Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien befähigen, in der Sekundarstufe I Kinder mit geistiger Behinderung bestmöglich individuell (zieldifferent) zu fördern, gäbe es keine Legitimation mehr dafür, nicht behinderte SchülerInnen nach der Grundschule wegen vermeintlich oder tatsächlich unterschiedlicher Leistungsfähigkeit einer dieser drei Schulformen zuzuweisen. Würde man dagegen nur den Hauptschulen (und Gesamtschulen) einen Inklusionsauftrag bis Klasse 10 geben, würde zum einen der Forderung nach Inklusion „auf allen Ebenen“ nicht entsprochen, und zum anderen würde die Hauptschule in der öffentlichen Meinung dann noch mehr als bisher als „Restschule“ für die „Problemfälle“ (gleichsam als Sonderschule neuen Typs) wahrgenommen, von der sich die anderen Schulformen noch stärker privilegiert abheben. Gleiches gälte auch im Fall einer „Zweigliedrigkeit“ der Sekundarstufe I (z. B. Hamburg: „berufsorientierte Stadtteilschule“ und „wissenschaftsorientiertes“ Gymnasium).
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die frühe Selektion der RegelschülerInnen nach der Grundschule als ein maßgeblicher Faktor für die erschreckend hohe soziale Selektivität unseres bisherigen Schulsystems identifiziert wurde. Die Verlängerung der gemeinsamen Lernzeit, der Verzicht auf frühe Selektion gilt allgemein als ein Schlüsselelement für die Herstellung von Chancengerechtigkeit in einem hochwertigeren, leistungsfähigeren Schulwesen. Von unterschiedlichen Ausgangspunkten kommend treffen sich somit die Reformbestrebungen für eine bessere Regelschule und für eine inklusive Regelschule in der Forderung nach einer Schule für alle bis Klasse 10.
Sollen Inklusion und Zieldifferenz Normalität werden, führt an einer entsprechenden Strukturreform unseres Schulsystems kein Weg vorbei. Das NRW-Bündnis „Eine Schule für alle“, dem auch der SoVD NRW angehört, hat das im Anhang beigefügte Papier über Leitlinien und Grundsätze einer Schule für alle erarbeitet, das die Zielperspektive skizziert.
Gegen einen Umbau des selektiven zum inklusiven Schulwesen wird vielfach die Behauptung in Stellung gebracht, dass die damit verbundene Kostenbelastung für die öffentlichen Haushalte nicht verkraftbar sei. Im UN-Handbuch für Parlamentarier zur Behindertenrechtskonvention werden inklusive Schulsysteme dagegen im Allgemeinen als kostengünstiger bewertet als Sonderschulsysteme („Inclusive educational settings are generally less expensive than segregated systems.“). Diese Auffassung wird in der Tendenz auch von deutschen Sachverständigen geteilt, die einen kostenneutralen Übergang vom Selektions- zum Inklusionssystem für möglich halten. (9) Haushalterische Überlegungen dürfen im Übrigen niemals einen Grund dafür liefern, einem Kind den Zugang zum Regelschulsystem zu versagen oder zu erschweren.
Allerdings besteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für Qualitätsverbesserungen im Regelsystem selbst, der nicht durch die Inklusionsorientierung bedingt ist, sondern durch die ohnehin bestehende Notwendigkeit zur Überwindung von Leistungsdefiziten der Schulen, insbesondere für Verbesserungen der Personalausstattung zur Vermeidung von Unterrichtsausfall und zur Sicherung ausreichend kleiner Klassenfrequenzen. Alle Kinder haben Anspruch auf Inklusion in guten, hochwertigen und auch sozial nicht selektiven Schulen.
Maßnahmen
Art. 8 BRK verpflichtet die Vertragsstaaten zu einer Reihe von Sofortmaßnahmen zur Bewusstseinsbildung. Dazu gehört u. a. eine öffentliche Kampagne zur Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen „auf allen Eben des Bildungssystems“. (10) Diese Kampagne kann und muss genutzt werden, um für den Strukturwandel vom selektiven zum inklusiven Bildungssystem und die Reform zugunsten einer Schule für alle bis Klasse 10 zu werben, über das Inklusionsziel, dessen menschenrechtliche Notwendigkeit und die darin liegenden Chancen für behinderte wie nicht behinderte SchülerInnen aufzuklären.
Zugleich ist der Strukturwandel zu einem inklusiven Regelschulsystem zielgerichtet und systematisch in Angriff zu nehmen. Kapazitätserweiterungen des Förderschulsystems sind deshalb unverzüglich wirksam auszuschließen.
Novelle des Schulgesetzes NRW
Das Schulgesetz NRW sollte entsprechend der folgenden Gesichtspunkte angepasst werden:
● Normierung eines ausdrücklichen generellen Vorrangs der inklusiven Beschulung in Regelschulen gegenüber der Förderschule, die Regelschule wird vorrangiger Ort der sonderpädagogischen Förderung;
● Schaffung eines vorbehaltlosen Elternwahlrechts mit Rechtsanspruch auf Gemeinsamen Unterricht;
● Aufhebung der Voraussetzung für Gemeinsamen Unterricht (zielgleich und zieldifferent), dass „die Schule dafür personell und sachlich ausgestattet ist“ (§ 20, Abs. 7 und 8 SchulG), stattdessen Verpflichtung zur Bereitstellung der notwendigen Ausstattung; (11)
● Normierung des Anspruchs auf umfassende – auch sonderpädagogische – Förderung und Unterstützung beim Besuch einer allgemeinen Schule, mindestens von der Qualität, die bislang in Förderschulen erbracht wird;
● Verpflichtung der Gemeinden und Kreise als Schulträger (§ 79 SchulG) sowie der Träger privater Ersatzschulen, Schulgebäude und –anlagen barrierefrei zu gestalten (12) und die Schulentwicklungsplanung (§ 80 SchulG) am Ziel einer Schule für alle auszurichten;
● Planmäßige Zusammenführung der Klassen 1 bis 10 in einer Schule für alle auf Basis entsprechender Übergangsregelungen.
Förderschulen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung
Es ist seit langem umstritten, ob Verhaltensstörungen, Sprach- und Lernschwierigkeiten, deren Diagnostizierung bislang die Aufnahme in die entsprechenden Förderschulen rechtfertigen, zu Recht als „Behinderung“ charakterisiert werden. Es spricht vieles dafür, dass es sich eher um Folgen sozial benachteiligter Milieus sowie mangelnder Förderfähigkeit der Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen handelt und nicht um eine Behinderung – weder im Sinne der sozialrechtlichen Definition (§ 2 SGB IX) noch im Sinne von Art. 1 BRK. Indes stellen SchülerInnen mit diesen Befunden die Mehrheit aller SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Zudem ist bildungswissenschaftlich belegt, dass die Förderschule Lernen nicht fördert, sondern bestehende Problemlagen eher verfestigt.
Nach Auffassung zahlreicher Sachverständiger sollten deshalb die genannten Förderschulzweige vorrangig und unverzüglich vollständig auslaufen, wobei die Regelschulen im Gegenzug regelmäßig eine entsprechende bedarfsgerechte Grundausstattung mit sonderpädagogischen Fachkräften erhalten. (13) Diese Frage sollte einer vorrangigen und frühzeitigen Klärung zugeführt werden, um sich ggf. ergebende Folgerungen zügig in den Reformprozess aufnehmen zu können.
Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
● Die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften für allgemeine Schulen ist inklusionsorientiert fortzuentwickeln. Der Erwerb grundlegender sonderpädagogischer Kompetenzen sollte obligatorischer Teil der Lehrerausbildung werden.
● Entsprechend Art. 24 Abs. 4 BRK sind „auf allen Ebenen des Bildungswesens“ Maßnahmen zur Schulung (Fortbildung) von Fachkräften und MitarbeiterInnen zu treffen, die Kompetenzen in Fragen von Behinderungen, geeigneter Kommunikationsmittel, pädagogischer Verfahren und Materialien vermitteln.
● Entsprechend der gleichen Bestimmung sollte die Zahl der Lehrkräfte, die selbst behindert sind, sowie die Zahl derer, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, sukzessive erhöht werden.
Leistungen der Eingliederungshilfe zum inklusiven Schulbesuch
Art. 24 Abs. 2 Buchstabe d) BRK fordert, notwendige Unterstützung zur Erleichterung des Bildungserfolgs „innerhalb“ des allgemeinen Bildungssystems zu leisten. Schon bei der Wahrnehmung bisheriger Integrationsmöglichkeiten besteht eine teils erhebliche Schwierigkeit darin, dass für notwendige ergänzende Hilfen zum Schulbesuch – etwa die Finanzierung einer Schulassistenz (IntegrationshelferIn, Begleitperson) – nicht der Schulträger, sondern der Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 54 SGB XII) zuständig ist. Immer wieder lehnen Sozialhilfeträger entsprechende Anträge ab; die Bewältigung dieser Schnittstelle unterschiedlicher Kostenträger ist den Eltern dann nur auf dem Klageweg möglich. So lange ein rechtssicherer Leistungsanspruch und eine Beseitigung der Schnittstellenprobleme durch bundesrechtliche Änderung noch nicht erreicht ist, sollte das Land auf eine Verwaltungspraxis der Sozialhilfeträger hinwirken, die diese Probleme entschärft. (14) Eine Verpflichtung zur entsprechenden Änderung der Praxis leitet sich auch aus Art. 4 Abs. 1 Buchstabe d) her, wonach alle mit der BRK nicht vereinbaren Handlungen oder Praktiken zu unterlassen sind und dafür Sorge zu tragen ist, dass staatliche Behörden und öffentliche Einrichtungen im Einklang mit der BRK handeln.
Kultusministerkonferenz
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat anlässlich der BRK ein Verfahren zur Fortentwicklung der sonderpädagogischen Leitlinien von 1994 eingeleitet. Die politischen Diskussionen um Art. 24 BRK haben deutlich werden lassen, dass die Kultusressorts mancher Länder sich einer inklusiven Bildungsreform noch widersetzen. Der SoVD NRW erwartet daher von der Landesregierung, in der KMK aktiv für den notwendigen Reformkurs und seine zügige und sachgerechte Umsetzung auch in den übrigen Bundesländern zu werben. Insbesondere sollte sie sich dafür einsetzen, dass die sonderpädagogischen Leitlinien von einem klaren Bekenntnis zu den Zielsetzungen der BRK geprägt sind und dementsprechend den Vorrang der gemeinsamen Beschulung und die Ablösung der Defizitorientierung durch die Teilhabeperspektive klar zum Ausdruck kommen.
Übrige Einrichtungen des Bildungswesens
Es sei darauf hingewiesen, dass der Handlungsauftrag zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen neben den allgemeinbildenden Schulen auch Kinderbetreuungseinrichtungen (Elementarstufe), Einrichtungen der beruflichen Bildung, Hochschulen, sowie Einrichtungen der Erwachsenenbildung einschließt. Auch hier sind die landesrechtlichen und förderpolitischen Regelungen, die Verwaltungspraxis sowie die baulichen Gegebenheiten auf ihre regelhafte Inklusionsfähigkeit und Geeignetheit zur Inklusionsförderung zu überprüfen und ggf. anzupassen.
2. Barrierefreiheit in den Bereichen Bauen und Verkehr
Nach Art. 9 [Zugänglichkeit] Abs. 1 BRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen zur Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und –barrieren unter anderem für „Gebäude, Straßen, Transportmittel … einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten“, die „der Öffentlichkeit offen stehen oder für sie bereitgestellt werden“. Abs. 2 verpflichtet außerdem zu Maßnahmen, um „sicherzustellen“, dass private Träger, die der Öffentlichkeit offen stehende oder für sie bereitgestellte Einrichtungen und Dienste anbieten, „alle Aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen“.
Bauen
Nach § 7 Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) haben Land und Kommunen die Errichtung oder die Änderung baulicher Anlagen „entsprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften“ barrierefrei zu gestalten. § 55 der Landesbauordnung (BauO NRW) bestimmt, dass öffentlich zugängliche bauliche Anlagen (auch solche in privater Trägerschaft) „in den dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen“ barrierefrei sein müssen. Die zitierte Beschränkung des Barrierefreiheitsgebotes, mit der Gebäudeteile, die von den dort Beschäftigten genutzt werden, von der Vorschrift ausgenommen werden, war schon wiederholt Gegenstand der Kritik des SoVD NRW und anderer Interessenvertretungen behinderter Menschen.
Nach Auffassung des SoVD NRW ist diese Beschränkung in § 55 BauO NRW in Folge Art. 9 BRK aufzuheben. Dies wäre keine Kompetenzüberschreitung mit Blick auf die Arbeitsstättenverordnung des Bundes. (15) Diese regelt Mindeststandards des Arbeitsschutzes (nicht des Baurechts) und sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, andere (ergänzende) Regelungen in der BauO zu treffen. (16)
Die Ausweitung der Barrierefreiheitsvorschrift des § 55 auf das ganze Gebäude trägt zudem auch zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten behinderter Menschen bei und erleichtert damit die Umsetzung von Art. 27 [Arbeit und Beschäftigung] BRK. § 3 Abs. 2 ArbStättV sieht eine Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung von Arbeitsplätzen erst dann vor, wenn behinderte ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden. Da Arbeitgeber nicht selten den damit verbundenen Aufwand scheuen (trotz Bereitstellung von Fördermitteln), wird eine Einstellung behinderter Menschen, die entsprechender Anpassungen bedürfen, häufig vermieden. In dem Maße, wie Arbeitsstätten ohnehin barrierefrei gestaltet sind, entfällt dieses Hindernis.
Ebenso ist der nur schwer nachvollziehbare Umstand zu bereinigen, dass die Unterrichtsräume von Schulen nach herrschender Rechtsauffassung nicht „dem allgemeinen Besucherverkehr“ dienen, weil SchülerInnen nicht als BesucherInnen, sondern als „NutzerInnen“ gelten. Nach dieser Auslegung hat § 55 BauO NRW – obwohl „Einrichtungen des Bildungswesens“ dort ausdrücklich genannt sind – für Schulgebäude erst dann rechtliche Bedeutung, wenn und soweit dort öffentliche Veranstaltungen stattfinden. (17) Ob diese Rechtsauffassung auch auf Einrichtungen des Gesundheitswesens (z. B. Arztpraxen: PatientInnen vs. BesucherInnen) Anwendung findet, ist uns derzeit nicht bekannt.
Ein großes Problem im Zusammenhang mit § 55 BauO NRW sind langjährig beklagte Vollzugsdefizite seitens der örtlichen Bauämter. Der SoVD NRW erwartet, dass die Landesregierung ihre Möglichkeiten ausschöpft, die Vollzugsdefizite unverzüglich zu beheben, so dass keine öffentlich zugängliche bauliche Anlage in NRW mehr ohne Beachtung von § 55 errichtet, umgebaut oder erweitert wird. Darüber hinaus sind Konsequenzen daraus zu ziehen, dass die Vorschrift nicht auf Errichtung, Um- oder Erweiterungsbauten abstellt, sondern generell zur Barrierefreiheit verpflichtet. Daraus ist die Verpflichtung herzuleiten, Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit innerhalb angemessener Fristen auch dann zu planen und durchzuführen, wenn eine anderweitige Umbaumaßnahme nicht bevorsteht. (18)
Im Übrigen wurde die Aufgabe, auf eine barrierefreie Gestaltung kommunaler Anlagen und Einrichtungen hinzuwirken, mit § 5 BGG NRW den Verbänden behinderter Menschen übertragen. Diese sollen hierzu freiwillige Zielvereinbarungen mit den Gemeinden, Kreisen, Kommunalverbänden oder deren Unternehmen aushandeln. Nicht selten müssen damit (bau-)rechtliche Vollzugsdefizite ausgeglichen werden. Der SoVD NRW hat dies bereits im Gesetzgebungsverfahren des BGG NRW als völlig unzureichend und strukturelle Überforderung der Verbände kritisiert. Um Barrierefreiheit auf kommunaler Ebene herbeizuführen, sind Zielvereinbarungen allein kein „geeignetes Mittel“ im Sinne der BRK.
Daher erneuert der SoVD NRW unter Verweis auf Art. 9 BRK seine Forderung nach einer rechtlichen Verpflichtung der Kommunen und des Landes, ihren Bestand an öffentlich zugänglichen baulichen Anlagen innerhalb angemessener Fristen barrierefrei umzugestalten. (19) Dabei können Zielvereinbarungen im Sinne des § 5 BGG NRW ein sinnvolles und hilfreiches Instrument der Partizipation der örtlichen Interessenvertretungen behinderter Menschen bei der Prioritätensetzung und der konkreten Ausgestaltung und Planung von Maßnahmen sein.
Darüber hinaus ist die Anforderung der Barrierefreiheit in die Allgemeinen Anforderungen des § 3 BauO NRW aufzunehmen, um ihr grundsätzlich für sämtliche Baumaßnahmen Geltung zu verleihen. Notwendig erscheinende Ausnahmen von diesem Grundsatz müssen – auch zur rechtssicheren Orientierung der Bauaufsicht – ausdrücklich normiert werden.
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) fordert, Mindeststandards und Leitlinien für die Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher Einrichtungen und Dienste „zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen“. In Gestalt der einschlägigen DIN-Normen liegen bereits anerkannte Barrierefreiheitsstandards für Gebäude, Wohnungen und Außenanlagen vor, deren Beachtung aber häufig nicht verbindlich ist.
Der SoVD NRW begrüßt, dass der Landesbetrieb Straßen.NRW den „Leitfaden für Barrierefreiheit im Straßenraum“ veröffentlicht hat. Dieser sollte für Landes- und kommunale Straßen verbindlich werden (z. B. untergesetzliche Regelung zu § 9 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz NRW).
Verkehr
Art. 9 BRK verlangt geeignete Maßnahmen, um die Zugänglichkeit auch der öffentlichen Verkehrsinfrastrukturen in städtischen und ländlichen Gebieten für Menschen mit Behinderung zu gewährleisten. Der Regelungskompetenz des Landes unterliegen hier der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Nach wie vor besteht erheblicher Handlungsbedarf, um das Ziel eines barrierefreien ÖPNV/SPNV in NRW in Reichweite zu bringen. Bei der Umsetzung der bereits bestehenden Barrierefreiheitsvorschriften des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) (20) bestehen erhebliche Defizite, die in einzelnen Fällen die örtlichen Interessenvertretungen behinderter Menschen veranlasst haben, den beschwerlichen Weg der Zielvereinbarungen zu beschreiten.
Der SoVD NRW sieht eine geeignete Maßnahme insbesondere darin, die Vergabe der Fördermittel nach dem ÖPNVG NRW künftig an die Voraussetzung zu knüpfen, dass die Aufgabenträger des ÖPNV und SPNV konkrete, mit zeitlichen Zielen und bezifferten Investitionsplanungen unterlegte Planungen zur vollständigen barrierefreien Umgestaltung ihres Angebots vorlegen und umsetzen. Bei der Erarbeitung dieser Pläne sind die Partizipationsrechte der Organisationen behinderter Menschen zu wahren.
Auch für den ÖPNV-Bereich ist der Auftrag der BRK bedeutsam, Mindeststandards und Leitlinien für Fahrzeuge, Haltestellen bzw. Bahnhöfe sowie den Übergang zwischen beiden zu entwickeln, zu erlassen und ihre Anwendung zu überwachen. Die barrierefreie Gestaltung des ÖPNV würde den kommunalen ÖPNV-Trägern dadurch erheblich erleichtert, weil sie nicht mehr in jedem Einzelfall mit den örtlichen Interessenvertretungen behinderter Menschen „eigene“ Barrierefreiheitskriterien entwickeln müssten. Die Anwendung der Standards würde dazu führen, dass die Fahrzeughersteller ausschließlich barrierefreie Fahrzeuge anbieten würden. Bei der Ausschreibung von ÖPNV-Dienstleistungen sind barrierefreie Angebote im Nachteil, wenn die Anbieter barrierefreie Fahrzeuge als teurere Sonderanfertigung bestellen müssen.
3. Selbstbestimmt barrierefrei Wohnen
Nach Art. 19 BRK haben die Vertragsstaaten zu „gewährleisten“, dass Menschen mit Behinderung
● „gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben“,
● „Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten … haben, einschließlich der persönlichen Assistenz“ und
● „gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit“ nutzen können.
Diese Bestimmungen gelten gleichermaßen für „klassische“ KlientInnen der Eingliederungshilfe wie für pflegebedürftige alte Menschen. Damit unvereinbar ist der Kostenvorbehalt bei der Gewährung ambulanter Leistungen in § 13 Abs. 1 Satz 3 SGB XII. Die Regelung ermächtigt den Sozialhilfeträger, eine Heimunterbringung gegen den Wunsch des Betroffenen für „zumutbar“ zu erklären und die Kostenübernahme für eine (teurere) ambulante Unterstützung zu verweigern. Der SoVD NRW fordert die Landesregierung auf, unverzüglich eine Bundesratsinitiative zur Aufhebung der Bestimmung einzubringen. Dabei ist auch die Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB XII (21) zu überprüfen, da diese einen Grundsatz formuliert, der durch die kritisierte Regelung des § 13 konkretisiert wird.
Das Land NRW hat seit 2003 – derzeit befristet bis 30.06.2013 – die Zuständigkeiten für ambulante und stationäre Wohnhilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe bei den Landschaftsverbänden zusammengeführt, um eine verstärkte Ambulantisierung der Wohnhilfen zu erreichen. Die erreichten und in Fortsetzung der bestehenden Maßnahmen zukünftig erreichbaren Fortschritte reichen jedoch nicht aus, um den Anforderungen der BRK zu genügen. Insbesondere Menschen mit höherem Unterstützungs- und Hilfebedarf werden nicht erreicht und haben weiterhin keine Alternative zum Heim. Zudem sind auch ambulant betreute Wohngruppen und Wohngemeinschaften meist noch „besondere Wohnformen“ im Sinne der BRK, die mit Einschränkungen des Entscheidungsrechts der Betroffenen, wo und mit wem sie leben, verbunden sind. Persönliche Assistenz ist nach wie vor nur für einen kleinen Kreis Betroffener zugänglich und praktikabel.
In Folge von Art. 19 BRK müssen heute die Bestrebungen zum Ausbau des ambulant betreuten selbstbestimmten Wohnens in den Kontext einer erweiterten Zielperspektive gestellt werden. Diese wird annähernd im Entwicklungsszenario C des Abschlussberichts „Selbständiges Wohnen behinderter Menschen“ der wissenschaftlichen Begleitforschung als „inklusives Gemeinwesen“ beschrieben. (22)
Behinderte Menschen müssen ungeachtet der Art und Schwere ihrer Behinderung die Möglichkeit haben, allein oder mit PartnerIn eine „normale“ Mietwohnung zu beziehen und die erforderliche tragfähige Unterstützung durch persönliche Assistenz oder ambulante Dienste zu erhalten. Der SoVD erwartet, dass die Landesregierung entsprechenden Einfluss auf die konzeptionelle Fortentwicklung des Engagements der hier maßgeblich zuständigen Landschaftsverbände beim Ausbau des selbstbestimmten Wohnens entsprechend Art. 19 BRK nimmt und diese zielgerichtet unterstützt.
Für den notwendigen Ausbau der Einrichtungen und Dienste zur Unterstützung der häuslichen Pflege, nicht zuletzt hinsichtlich des Leistungsumfangs, sind vor allem bundesrechtliche Fortentwicklungen notwendig, die hier nicht vertieft werden sollen. Allerdings sind in diesem Zusammenhang auch die pflegeergänzenden („komplementären“) Dienste zu berücksichtigen, die zur Entwicklung tragfähiger häuslicher Pflegesettings wesentlich beitragen können. Dabei dürfen keine „Preisbarrieren“ entstehen, die den Zugang zu tragfähiger Unterstützung in der eigenen Häuslichkeit von den persönlichen Einkommensverhältnissen abhängig machen. Mit dem Landespflegegesetz (1996) wurde der Sicherstellungsauftrag für die bis dahin landesgeförderte Infrastruktur der „komplementären ambulanten Dienste“ den Kommunen übertragen, während das Land sich weitgehend aus der Aufgabe zurückzog. Die Kommunen ihrerseits haben diese Aufgabe vielfach nicht angenommen, ohne dass dies Interventionen des Landes ausgelöst hätte. In der Folge wurde das Thema pflegeergänzender Dienste in den Zusammenhang der Erschließung eines Wettbewerbsmarktes „haushaltsnaher Dienstleitungen“ gestellt. Die Inanspruchnahme entsprechender Angebote ist jedoch vielen Pflegebedürftigen aus Kostengründen nicht möglich.
Der SoVD NRW hält es im Sinne der Art. 19 und 22 [Achtung der Privatsphäre] BRK für zwingend, im Landesheimrecht (Wohn- und Teilhabegesetz – WTG) das Recht auf ein Einzelzimmer zu verankern. Im Gesetzgebungsverfahren zum WTG haben sich bereits alle Landtagsfraktionen politisch zu dieser Zielsetzung bekannt, wenngleich sie (noch) mehrheitlich auf eine entsprechende Regelung verzichteten.
Nach Art. 4 BRK sind die Vertragsstaaten zur Förderung der „Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Personal“ bezüglich der in der BRK anerkannten Rechte verpflichtet. (23) Solche Schulungsmaßnahmen sind nicht nur für Beschäftigte von Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Pflege zu organisieren, sondern auch für die Einrichtungsleitungen sowie für die „Entscheider“ in den Verbänden der Leistungserbringer und der Kostenträger. Insbesondere die Letzteren haben wesentlichen Einfluss darauf, ob und wie rasch die Hilfe- und Unterstützungsstrukturen in Richtung des inklusiven Gemeinwesens entwickelt werden. Die Landesregierung sollte sich daher mit den Verbänden über die Aufstellung entsprechender Schulungsangebote ins Benehmen setzen und diese – soweit erforderlich – finanziell unterstützen.
Neben dem Zugang zu den erforderlichen ambulanten Hilfen ist der Zugang zu geeignetem barrierefreiem Wohnraum die zweite notwendige Voraussetzung zur Verwirklichung des Rechts auf selbstbestimmtes Wohnen. Barrierefreie Mietwohnungen, die auch finanziell schwächeren MieterInnen (24) offen stehen, sind bislang noch in viel zu geringem Umfang vorhanden. Für die Verwirklichung der Rechte des Art. 19 sind Maßnahmen zur barrierefreien Umgestaltung von Bestandswohnungen besonders bedeutsam, da Neubaumaßnahmen nur noch in geringem Umfang zum Wohnungsangebot beitragen. Im Rahmen der Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest) hat die Landesregierung ein Förderinstrument für Maßnahmen zur barrierefreien Umgestaltung von Bestandswohnungen bereitgestellt; zum 01.04.09 startete das KfW-Förderprogramm für barrierereduzierende Modernisierungen.
Jedoch kann mit diesen Instrumenten allein der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum, der im Zuge der demografischen Entwicklung weiter zunimmt, nicht gedeckt werden. Bisherige bauordnungsrechtliche Zumutbarkeitsregelungen, Schwächen der Bauaufsicht und vereinfachte Genehmigungsverfahren führten dazu, dass die Modernisierung des Mietwohnungsaltbestandes in der Regel ohne Berücksichtigung der Barrierefreiheit stattfindet. Hinzu kommen der Bedeutungsverlust des Sozialwohnungsbaus und die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes mit öffentlichen Belegungsrechten zugunsten von am Markt benachteiligten Gruppen. Der SoVD NRW fordert die Landesregierung auf, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um innerhalb angemessener Fristen ein bedarfsgerechtes Angebot an barrierefreien Wohnungen zu erreichen.
4. Öffentlich zugängliche Dienste und Einrichtungen
Nach Art. 9 treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Allgemeinheit zugängliche Einrichtungen und Dienste in öffentlicher wie in privater Trägerschaft für Menschen mit Behinderung zugänglich (barrierefrei) sind. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsinfrastrukturen, die für vielfältige Aufgabenbereiche (wenngleich noch nicht immer bedarfsgerecht) von kommunalen, frei gemeinnützigen Trägern bereitgestellt werden. Teilweise werden die Einrichtungen regelmäßig mit Fördermitteln des Landes unterstützt.
In den landesgeförderten Bereichen sollte das Land gemeinsam mit den Trägern unter Beteiligung sachkundiger InteressenvertreterInnen behinderter Menschen eine Bestandsaufnahme des Barriere(freiheits)status einschließlich der Kommunikationsfragen vornehmen, um die konkreten Handlungsbedarfe im Sinne des Art. 9 zu identifizieren. Da die Finanzierung der Einrichtungen häufig als „Komplementärfinanzierung“ unter Beteiligung einer Mehrzahl von Kostenträgern organisiert ist, sollten unter Beteiligung der weiteren Kostenträger Maßnahmeplanungen zur Herstellung von Barrierefreiheit entwickelt werden, deren Finanzierung von den beteiligten Kostenträgern gemeinsam sichergestellt wird. Die Landesregierung sollte hier initiierend und moderierend tätig werden. Zugleich sollte sie nach Möglichkeit sicherstellen, dass neue Einrichtungen nur dann ans Netz gehen, wenn sie die Anforderungen der BRK erfüllen.
Erheblicher Handlungsbedarf besteht bei Arztpraxen, deren Barrierefreiheit zur Verwirklichung des Art. 25 BRK unerlässlich ist. Die Landesbehindertenbeauftragte hat dieses Thema zu Recht zum Gegenstand einer Kampagne gemacht. Allerdings ist äußerst fraglich, ob im Wege der Aufklärung, Werbung und ggf. von Anreizen das Ziel erreichbar wird. Die Beseitigung bestehender Vollzugsdefizite bei § 55 BauO NRW wäre sicher auch in diesem Bereich hilfreich. Als ein geeignetes Mittel er erscheint aber insbesondere, ein Barrierefreiheitsgebot als Zulassungsvoraussetzung in die ärztlichen und zahnärztlichen Zulassungsverordnungen aufzunehmen. Hierauf sollte das Land NRW über die Gesundheitsministerkonferenz hinwirken.
Handlungsbedarf besteht ebenfalls bei den Frauenhäusern (25) sowie bei geeigneten Maßnahmen der Gewaltprävention, insbesondere gegen sexuelle (sexualisierte) Gewalt. Einschlägige Befunde deuten darauf hin, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung häufiger sexueller Gewalt zum Opfer fallen als nicht behinderte Frauen. (26) Nach Auffassung des SoVD dürfen die einschneidenden Haushaltskürzungen, die mit dem Landeshaushalt 2006 in diesen Bereichen vorgenommen wurden, keinen Bestand haben. Insbesondere haben sie die Leistungsfähigkeit der Frauenhäuser in Frage gestellt. Bundesweit sind bislang nur rund 10 % der Frauenhäuser barrierefrei zugänglich; eine entsprechende Angabe für NRW liegt uns nicht vor.
Der SoVD NRW sieht hier aufgrund von Art. 16 in Verbindung mit Art. 6 BRK das Land und die Kommunen in der Verantwortung, die barrierefreie Umgestaltung der Frauenhäuser, deren qualifizierte Arbeit zugunsten der Gewaltopfer sowie erforderliche Lückenschlüsse in der Infrastruktur auch finanziell verstärkt zu fördern.
5. Behindertengleichstellungsgesetz NRW
Anpassungsbedarf im BGG NRW sieht der SoVD NRW insbesondere bezüglich
● der Ergänzung der Legaldefinition von Benachteiligung (Diskriminierung) in § 3 Abs. 2 um den in Art. 2 BRK formulierten Diskriminierungstatbestand der „Versagung angemessener Vorkehrungen“.
Die Konvention schafft gleichsam ein Individualrecht auf angemessene Vorkehrungen, die – soweit sie keine unverhältnismäßige und unbillige Belastung darstellen – in einem bestimmten Einzelfall vorzunehmen sind, damit die in der BRK formulierten Menschenrechte und Grundfreiheiten wahrgenommen werden können. Dies kann beispielsweise der Anspruch auf Anbringung einer provisorischen Rampe sein, um einer Schülerin im Rollstuhl den Zugang zu einer Regelschule (oder einer anderen Einrichtung) zu ermöglichen, oder der Anspruch auf Anbringung einer Beschilderung in Brailleschrift.
● der Einfügung einer Verpflichtung der kommunalen Körperschaften, Verbände und Unternehmen, ihre öffentlichen Infrastrukturen barrierefrei zu gestalten (vgl. oben Abs. „Bauen“) und hierzu unter Beteiligung der örtlichen Interessenvertretungen behinderter Menschen zeitlich definierte Maßnahmepläne zu entwickeln und fortzuschreiben. Die Regelungen des § 5 BGG NRW sollten dann auf die konkrete Ausgestaltung der Planungen bezogen werden für den Fall, dass ein Einvernehmen über die Maßnahmen im Verwaltungsverfahren nicht erzielt wird.
6. Öffentlich-rechtliche Medien
Im Rahmen des Landesbehindertenrates NRW (LBR) hat sich auch der SoVD seit längerer Zeit für einen Barriereabbau im Programmangebot von Rundfunk und Fernsehen sowie für ein realitätsnahes und respektvolles Bild behinderter Menschen in den Medien eingesetzt. Dies sind auch Ziele der BRK.
Zu den Sofortmaßnahmen nach Art. 8 [Bewusstseinsbildung] BRK gehört „die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen“. Nach Art. 21 BRK gehört zu den Maßnahmen, mit denen die Vertragsstaaten die Ausübung des Freiheitsrechts zu Beschaffung, Empfang und Weitergabe von Informationen und Gedankengut durch alle von behinderten Menschen gewählten Kommunikationsformen im Sinne des Art. 2 BRK „gewährleisten“, die Aufforderung an die Massenmedien (einschließlich Internet-Anbietern), ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zugänglich zu gestalten. Die Sofortmaßnahme (Art. 8 Buchstabe d) „Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderungen und für deren Rechte“ sollte in diesem Zusammenhang zur Qualifizierung von Medienschaffenden genutzt werden.
Der Landesregierung obliegt die Umsetzungsverantwortung in diesem Bereich insbesondere für den WDR und andere öffentlich-rechtliche Anbieter. Die Fachveranstaltung des LBR „Behinderung und Medien“ am 08.01.09 in Kooperation mit WDR und Landesregierung hat sowohl erzielte Fortschritte gewürdigt, als auch auf weitere Handlungsbedarfe hingewiesen. Es wird näher zu prüfen sein, ob Anpassungen („geeignete Maßnahmen“ i. S. Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a) BRK) im WDR-Gesetz und im Landesmediengesetz möglich sind, die zur Erreichung der Ziele des Art. 21 beitragen.
7. „Disability Mainstreamig“
Art. 4 Abs 1 Buchstabe c) BRK verlangt, den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen „in allen politischen Konzepten und allen Programmen“ zu berücksichtigen. Damit ist in den Allgemeinen Verpflichtungen der Konvention das Postulat eines „Disability Mainstreamings“ nach dem Vorbild des „Gender Mainstreaming“ (27) formuliert.
Hierzu sind geeignete Verfahren zu entwickeln, mit denen alle Ressorts der Landesregierung einschließlich ihrer nachgeordneten Behörden bereits in der Vorhabenplanung regelmäßig die zu erwartenden Auswirkungen auf die Rechte behinderter Menschen prüfen und ggf. Anpassungsbedarfe im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen. Dies setzt die regelhafte Beteiligung von Personen voraus, die über die erforderlichen Kompetenzen in Fragen der Belange behinderter Menschen verfügen.
Partizipation
Die Vorbereitung, Durchführung und Überwachung der Umsetzungsprozesse der BRK auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bringen vielfältige Partizipationsaufgaben für die Organisationen behinderter Menschen mit sich, die zu den bisherigen hinzutreten. In einigen Bereichen wird die Umsetzung der BRK auch unter Annahme günstigster Rahmenbedingungen eine Reihe von Jahren in Anspruch nehmen, bis die Zielstellungen verwirklicht sind.
Einige der ehrenamtlich arbeitenden Organisationen sind bereits durch bestehende Partizipationsaufgaben an den Grenzen ihrer materiellen und personellen Ressourcen angelangt. Kleine Organisationen haben bereits Schwierigkeiten, die Reisekosten zu Sitzungsterminen aus eigenen Mitteln zu tragen. Um asymmetrische Kräfteverhältnisse zwischen professionellen ExpertInnen aus Verwaltungen einerseits und VertreterInnen von Betroffenenorganisationen andererseits möglichst abzubauen, müssen Betroffenenorganisationen zur Beurteilung rechtlicher und fachlicher Sachverhalte ggf. auch auf professionellen externen Sachverstand zurückgreifen können. Angesichts des voraussichtlichen Umfangs partizipationsrelevanter Klärungsprozesse in vielfältigen Sachgebieten sollte daher frühzeitig die Frage beantwortet werden, in welcher Weise den Betroffenenorganisationen notwendige Unterstützung zur Verfügung gestellt werden kann.
Einen Ansatz sieht der SoVD NRW darin, das der Unterstützung der Behindertenselbsthilfe dienende Teilprojekt der agentur barrierefrei NRW unter Fortführung seiner bisherigen Unterstützungsarbeit bei Zielvereinbarungen nach BGG NRW zu einem leistungsfähigen Kompetenzzentrum in allen Fragen der Barrierefreiheit fortzuentwickeln. (28) Dieses sollte die Partizipation der Betroffenenorganisationen bei der Umsetzung der BRK auf Landes- wie kommunaler Ebene im Bedarfsfall unentgeltlich unterstützen, auch mittels eines Pools geeigneter Sachverständiger, die zu beratender Unterstützung bereit sind. Unterstützungsbedarfe werden aber auch in den anderen Bereichen jenseits des Art. 9 BRK bestehen. In jedem Fall sollte vermieden werden, dass sich eine Kluft zwischen den Partizipationsansprüchen der BRK und den tatsächlichen quantitativen wie qualitativen Partizipationsmöglichkeiten entwickelt.
********************************************
Fußnoten
(1) vgl. Art. 4 Abs. 5 UN-BRK
(2) vgl. Art 4 Abs. 1 Buchst. a) i. V. mit Buchstabe d) BRK
(3) vgl. Art. 4 Abs. 3 UN-BRK; dies gilt gleichermaßen bei an anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen.
(4) Deutsch zählt nicht zu den Amtssprachen der Vereinten Nationen.
(5) Der Begriff der „angemessenen Vorkehrungen“ ist in Art. 2 BRK definiert; deren Versagung ist ein Diskriminierungstatbestand.
(6) Für den deutschen Sprachgebrauch ist diese begriffliche Unterscheidung vergleichsweise neu. In der Vergangenheit wurde häufig von Integration gesprochen, wo Inklusion gemeint war.
(7) Zitiert nach: SoVD e.V., UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen – Inklusive Bildung verwirklichen, Berlin 2009, S. 3
(8) vgl. etwa die Ausführungen von Prof. Dr. Hans Wocken in der Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 20.05.09 – APr 14/896 S. 16 ff.
(9) vgl. etwa Prof. Preuss-Lausitz, Stellungnahmen 14/2362 und 14/2591 gegenüber dem Landtag NRW
(10) vgl. Art. 8 Abs. 2 Buchstabe b)
(11) Im Einzelfall ergibt sich diese Verpflichtung unmittelbar aus Art. 24 Abs. 2 Buchstabe c) BRK: Sicherstellung „angemessener Vorkehrungen“, die in Art. 2 definiert sind.
(12) Diese Verpflichtung ergibt sich auch unmittelbar aus Art. 9 BRK.
(13) So auch Prof. Dr. Wocken in APr 14/896
(14) Gleiches gilt auch für die Auslegung des Begriffs der „wesentlichen“ Behinderung zur Definition des Personenkreises, der Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe hat, in § 53 Abs. 1 SGB XII.
(15) In ihrem Bericht über die Wirkungen des BGG NRW hatte die Landesregierung die entsprechende Forderung des SoVD und anderer Behindertenverbände mit der Behauptung fehlender Regelungskompetenz aufgrund der ArbStättVO zurückgewiesen.
(16) vgl. § 3 Abs. 4 ArbStättV
(17) Quelle: Ausführungen des Ministeriums für Bauen und Verkehr im Landesbehindertenbeirat vom 05.03.2009. Die zitierte Rechtsauslegung ist als mit der BRK unvereinbare Praxis gem. Art. 4 Abs. 1 Buchstabe d) durch eine Auslegung im Sinne der Inklusion und Barrierefreiheit abzulösen.
(18) Die geforderte Änderung der Auslegung und der Vollzugspraxis von § 55 BauO ergibt sich auch unmittelbar aus Art. 4 Abs. 1 Buchstabe d) BRK, wonach mit der BRK nicht vereinbare Handlungen oder Praktiken zu unterlassen sind und dafür Sorge zu tragen ist, dass staatliche Behörden und öffentliche Einrichtungen im Einklang mit der BRK handeln.
(19) Da es sich um eine Maßnahme zur Umsetzung der BRK handelt, die auch die kommunale Ebene unmittelbar verpflichtet, dürften sich Konnexitätsfragen (kommunaler Anspruch auf Finanzausgleich bei Aufgabenübertragung durch das Land) hier nicht stellen.
(20) § 2 Abs. 8 ÖPNVG verpflichtet generell zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit „bei Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur, der Fahrzeuge sowie des Angebotes des ÖPNV“. § 8 Abs. 1 greift dies für die Erstellung der Nahverkehrspläne ausdrücklich auf. § 2 Abs. 3 verlangt die landesweite Entwicklung einer koordinierten Fahrgastinformation unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen.
(21) Im Wortlaut: „Der Träger der Sozialhilfe soll in der Regel Wünschen nicht entsprechen, deren Erfüllung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre.“
(22) ZPE der Universität Siegen, Selbständiges Wohnen behinderter Menschen – Hilfen aus Einer Hand, Abschlussbericht, August 2008; vgl. hier: S. 345 ff.
(23) vgl. Art. 4 Abs. 1 Buchstabe i) BRK
(24) Ende Juli 2009 bezogen in NRW 62,2 % der in der registrierten schwerbehinderten Erwerbslosen Leistungen nach dem SGB II. Die durchschnittliche Höhe der Erwerbsminderungsrenten lag Ende 2007 bei 761 Euro (alte Bundesländer).
(25) Die Frauenberatungsstellen sind in die vorstehenden Ausführungen zu Beratungseinrichtungen eingeschlossen.
(26) vgl. Landtag NRW (Hrsg.), Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW, Bericht der Enquetekommission des Landtags von Nordrhein-Westfalen, S. 159 f.
(27) [1] Gender Mainstreaming verlangt die Berücksichtigung des Zieles der Gleichstellung der Geschlechter bei sämtlichen politischen Maßnahmen einschließlich der Haushaltsgesetzgebung. („Gender Budgeting“). Die Umsetzung der Verpflichtungen des Gender Mainstreaming erscheint bislang unbefriedigend.
(28) vgl auch die einmütig verabschiedete Resolution der Delegiertenversammlung des LBR vom 14.03.09 zur Sicherung und Fortentwicklung der agentur barrierefrei NRW
Der ABA Fachverband unterstützt ausdrücklich das vorstehende Positionspapier des SoVD Landesverbandes NRW.










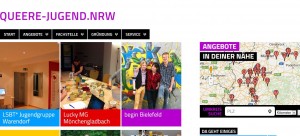









 Foto: Rainer Deimel
Foto: Rainer Deimel



