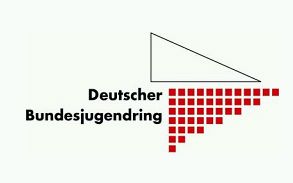NAGEL-Redaktion – Ehrenamt – Freiwilliges Engagement
Freiwilliges Engagement – früher nannte man es Ehrenamt – spielt eine wichtige Rolle. Auch in der Offenen Arbeit hat das Ehrenamt seine Relevanz, etwa bei den Spielplatzpaten.
Zum Herunterladen
Vorstehend können Sie eine Broschüre zum Unfallschutz im Ehrenamt herunterladen.
MONITOR ENGAGEMENT

Im April 2010 wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend der MONITOR ENGAGEMENT herausgegeben. Er befasst sich mit freiwilligem Engagement in Deutschland (1999 – 2004 – 2009) und fasst die Ergebnisse der repäsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement zusammen. Bei Interesse können Sie die Unterlagen mittels Klicks auf nachstehende Links herunterladen.
Monitor Engagement (Ausgabe 2: Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 – 2004 – 2009) Kurzbericht des 3. Freiwlligensurveys – Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement
Herunterladen (1,4 MB)
Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009 (Zivilgeselllschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagment in Deutschland 1999 – 2004 – 2009)
Inhalt (unter anderem)
Öffentliches Leben und freiwilliges Engagement
Stärken und Grenzen des Freiwiliigensurveys
Trend-Indikatoren
Mehr öffentliches, weniger privates soziales Kapital?
Freiwilliges Engagement – das Herz der Zivilgesellschaft
Selbstverständnis, Motive und Erwartungen freiwillig Engagierter
Bereitschaft nicht Engagierter, sich zu engagieren
Trends in verschiedenen Bevölkerungsgruppen
Strukturen des freiwlligen Engagements und Verbesserungsbedarf
Zeitliche Beanspruchung der Freiwilligen
Leistungen und Anforderungen im Engagement
Zielgruppen des freiwilligen Engagements (hier u.a. Kinder, Jugendliche und Familien)
Internetbenutzung im Engagement
Monetarisierung: Das materielle element
Verbesserungsbedarf bei den Rahmenbedingungen
Herunterladen (4,3 MB)
Hauptbericht des Freiwilligensurveys 2009 (Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 – 2004 – 2009) Zusammenfassung
Herunterladen (2,3 MB)
Jugend in der Zivilgesellschaft: Freiwilliges Engagement Jugendlicher von 1999 bis 2009 (Von Sibylle Picot im Auftrag der Bertelsmann Stiftung) Kurzbericht April 2011

Die Turbo-Studiengänge und die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur seien Schuld daran, dass sich Jugendliche immer weniger für die Gesellschaft engagierten. So eine Feststellung aus der Studie, die gezielt mit dem ehrenamtlichen Verhalten von Schülern und Studenten nachgegangen ist. Freundlicherweise hat uns Nicole Henrichfreise vom „Programm Zukunft der Zivilgesellschaft“ am 12. April 2012 eine aktualisierte 2. Auflage zugesandt. Diese haben wir nunmehr hier eingestellt.
Jugendliches Ehrenamt fördert demokratische Kompetenzen
Zu dieser Erkenntnis gelangt eine Studie der Universität Würzburg, die Prof. Dr. Heinz Reinders in Kooperation mit dem VCP, dem Verband christlicher Pfadfinder, 2007 durchgeführt hat. Die Dokumentation hierzu kann nachfolgend heruntergeladen werden. Hier wird folgende Kernaussage getroffen: „Jugendliche, die sich sozial engagieren, erleben sich stärker als Teil der Gesellschaft und sind häufiger zu politischer Beteiligung bereit.“Heinz Reinders: „Wenn neun von zehn Jugendlichen durch ihr Engagement etwas Neues gelernt haben und ihre demomkratische Kompetenz dadurch steigt, dann ist doch eine verstärkte Förderung jugendlichen Engagements ohne Alternative.“
Dokumentation herunterladen
Tagungsdokumentation „Engagement verändert – Freiwilliges Engagement und Entwicklung von Demokratie“
Die Dokumentation (15 Seiten, 1.972 KB) wurde uns am 19. Dezember freundlicherweise von Oliver Hesse von der FreiwilligenAgentur Dortmund zur Verfügung gestellt.
Inhalt
- Der Staat, der die Zivilgesellschaft stärkt, stärkt sich selbst.
- Die Demokratisierung verbandlicher Strukturen durch Personalentwicklung – eine neue Art von Organisationsentwicklung
- Politische Partiziaption
- Jugend und Partizipation
- Demokratische Strukturen in Verbänden und Einrichtungen
- Freiwilligenkoordination
- Die Martkplatzmethode als Instrument des Corporate Citizenship
Dokumente
Führungszeugnisse für Ehrenamtliche
Der Sprecherrat des ABA Fachverbandes hat sich auf seiner Arbeitstagung vom 10. November 2008 mit dem Thema Führungszeugnisse für Ehrenamtlich befasst. Seitdem existieren zwei Arbeitspapiere, die unser Sprecherratsmitglied Christa Burghardt vom Kinderschutzbund Hagen zur Verfügung gestellt hat. Im ersten geht es generell um Führungszeugnisse. Ein weiteres ist der Vorschlag für eine „Ehrenerklärung“, die seit längerem beim Hagener Kinderschutzbund genutzt wird. Wir empfehlen beispielsweise beim Einsatz von Spielplatzpaten einen entsprechenden Gebrauch.
Polizeiliche Führungszeugnisse für Ehrenamtliche
Ehrenerklärung für Ehrenamtliche
Im Juni 2010 hat der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) ein Hintergrundpapier zur Positionsbeschreibung veröffentlicht. Titel: Führungszeugnisse für Ehrenamtliche – ein geeigneter Beitrag zur Prävention sexuellen Missbrauchs in Jugendverbänden? Neben einer Einschätzung der Problemlage, befasst sich das Hintergrundpapier unter anderem mit der Aussagekraft von Führungszeugnissen, präventiven Maßnahmen, den Übergängen zwischen informellen und nonformalen Zusammenhängen, der Datenschutzproblematik, dem Aufwand im Vergleich zum Nutzen u.a.m. Der ABA Fachverband sieht eine Übertragbarkeit vor allem beim Einsatz ehrenamtlicher Spielplatzpaten. Heruntergeladen werden kann das Papier mittels eines Klicks auf vorstehendes Logo des DBJR.
Prävention statt statt Führungszeugnisse! Auf diese griffige Formel bringt der Landesjugendring Nordrhein-Westfalen seine Position. Er verwendet sich dafür, ein angemessenes Problembewusstsein zu schaffen, zu sensibilisieren und aufzuklären. Ebenso setzt er sich für eine entsprechende Qualifizierung derjenigen ein, die in der Kinder- und Jugendarbeit Verantwortung übernehmen. Nach Meinung des Landesjugendrings NRW stellt die Einführung von Führungszeugnissen für Ehrenamtliche Hunderttasusende unter Generalverdacht; dies behindere zivilgesellschaftliche Gestaltungskraft. Ehrenamt verdiene Vertrauen, Anerkennung und Strukturen, die es unterstützuen und nicht erschweren. Dieser Aussage kann sich der ABA Fachverband inhaltlich nur anschließen. Der Beschluss des Landesjugendrings NRW kann mittels eines Klicks auf vorstehendes Logo heruntergeladen werden.
NAGEL-Redaktion – Ehrenamt – Freiwilliges Engagement Read More »